Schnellzugriffsleiste

Thermische Bauphysik
Die Thermische Bauphysik spielt eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung von Gebäuden und der Verbesserung ihrer Energieeffizienz. Sie umfasst verschiedene Schlüsselbereiche, die bei der Planung, Sanierung und Bewertung von Gebäuden berücksichtigt werden müssen.
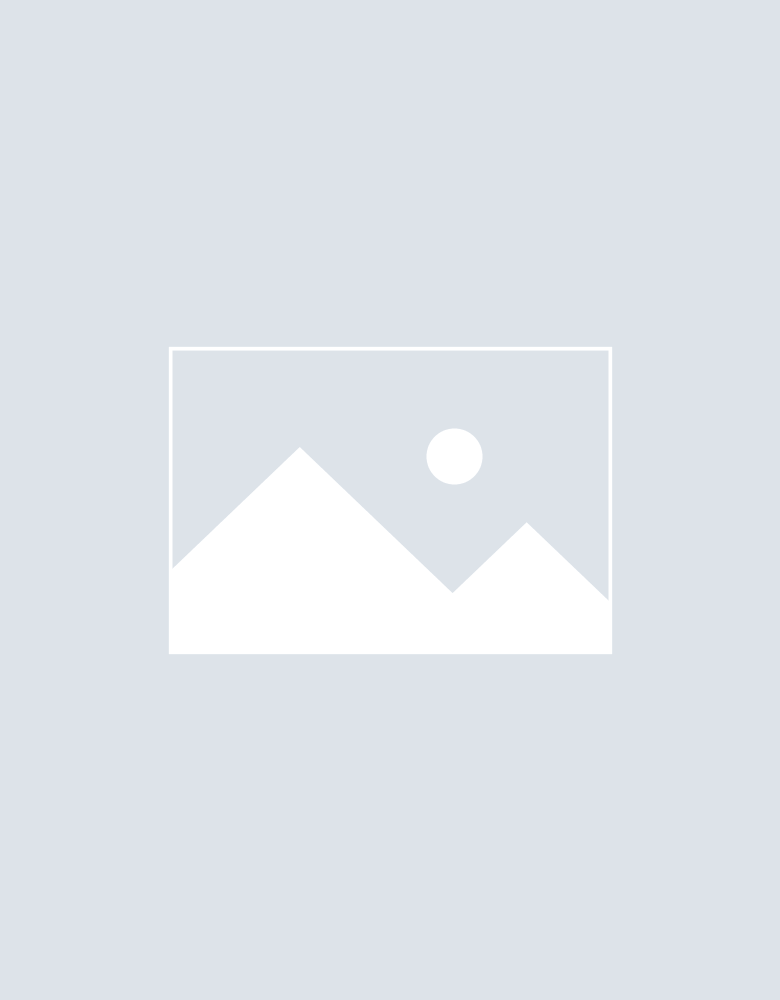
GEG-Bilanzierung
Die GEG-Bilanzierung bewertet die Energieeffizienz von Gebäuden gemäß dem Gebäudeenergiegesetz in Deutschland, um den Energieverbrauch zu optimieren und die Nachhaltigkeit im Bauwesen zu fördern.
Der individueller Sanierungsfahrplan
1
Energieeffizienz-Analyse: Eine gründliche Analyse des Energieverbrauchs und der energetischen Schwachstellen des Gebäudes ist der erste Schritt. Hierbei werden Daten zur Heizung, Kühlung, Beleuchtung und Isolierung erfasst, um den aktuellen Zustand zu bewerten.
2
Definition von Zielen und Maßnahmen: Basierend auf der Analyse werden klare Ziele für die Sanierung festgelegt. Dies kann die Reduzierung des Energieverbrauchs, die Verbesserung der Wärmedämmung, der Einsatz erneuerbarer Energien oder andere Effizienzmaßnahmen umfassen. Die festgelegten Maßnahmen sollten detailliert beschrieben werden.
3
Zeitplan und Kostenplan: Ein Sanierungsfahrplan sollte auch einen Zeitplan enthalten, der angibt, wann die einzelnen Maßnahmen durchgeführt werden, und einen Kostenplan, der die geschätzten Kosten für jede Maßnahme auflistet. Dies ermöglicht eine bessere Budgetierung und Zeitplanung.
4
Qualitätskontrolle und Überwachung: Während der Umsetzung des Sanierungsfahrplans ist eine kontinuierliche Überwachung und Qualitätskontrolle wichtig, um sicherzustellen, dass die Maßnahmen wie geplant durchgeführt werden und die angestrebten Ziele erreicht werden. Dies kann die regelmäßige Überprüfung der Baumaßnahmen und die Messung des Energieverbrauchs nach der Sanierung umfassen.
Die BAFA fördert ihren Sanierungsfahrplan mit 80% des Gesamtkosten.
Energieausweisbedarf
1
Gebäudeinformationen: Der Energiebedarfsausweis enthält detaillierte Informationen über das bewertete Gebäude, einschließlich der Gebäudedaten wie Baujahr, Gebäudenutzung, Wohnfläche und Anzahl der Wohnungen oder Räume.
2
Berechnung des Energiebedarfs: Der Ausweis enthält eine Berechnung des theoretischen Energiebedarfs des Gebäudes. Dieser Energiebedarf berücksichtigt die Gebäudehülle, die Wärmedämmung, die Heizungsanlage und andere energetische Aspekte, um den Heiz- und Kühlbedarf zu ermitteln.
3
Energetische Bewertung: Auf Grundlage der Berechnungen erfolgt eine energetische Bewertung des Gebäudes. Dies zeigt, wie effizient das Gebäude in Bezug auf den Energiebedarf ist und kann mit verschiedenen Energieeffizienzklassen oder -skalen dargestellt werden, um die Vergleichbarkeit zu ermöglichen.
4
Empfehlungen zur Verbesserung: Der Energiebedarfsausweis kann auch Empfehlungen zur Verbesserung der Energieeffizienz des Gebäudes enthalten. Diese Empfehlungen können Maßnahmen zur Sanierung, zur Verbesserung der Wärmedämmung oder zur Modernisierung der Heizungsanlage einschließen, um den Energiebedarf zu reduzieren.
Für diese Berechnungsart werden detaillierte Baupläne für die Erstellung benötigt.
Energieausweisverbrauch
1
Verbrauchsdaten: Der Energieverbrauchsausweis enthält Daten zum tatsächlichen Energieverbrauch des Gebäudes, oft über einen Zeitraum von mehreren Jahren. Dies können Angaben zum Heiz- und Warmwasserverbrauch sowie zum Stromverbrauch sein.
2
Vergleich mit Durchschnittswerten: Der Ausweis ermöglicht einen Vergleich des tatsächlichen Energieverbrauchs des bewerteten Gebäudes mit Durchschnittswerten für ähnliche Gebäude, um die Effizienz im Verhältnis zu anderen Gebäuden einzuschätzen.
3
CO2-Emissionen: Der Ausweis kann auch Informationen über die CO2-Emissionen des Gebäudes basierend auf dem Energieverbrauch anzeigen. Dies verdeutlicht den ökologischen Fußabdruck des Gebäudes.
4
Empfehlungen zur Verbesserung: In einigen Fällen kann der Energieverbrauchsausweis Empfehlungen zur Verbesserung der Energieeffizienz enthalten. Diese Empfehlungen können Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen umfassen.
Für diese Berechnungsart benötigt man den tatsächlichen Verbrauch der letzten 3 Jahre des Gebäudes.
Sommerlicher Wärmeschutznachweis
1
Berechnung des sommerlichen Wärmeschutzes: Der Nachweis beinhaltet eine Berechnung, die die Wärmeaufnahme und -abgabe des Gebäudes während der warmen Jahreszeiten berücksichtigt. Dies ermöglicht die Beurteilung des Innenraumklimas und der thermischen Behaglichkeit im Sommer.
2
Einflussfaktoren und Parameter: Der Nachweis berücksichtigt verschiedene Einflussfaktoren, wie die Gebäudeausrichtung, die Beschaffenheit der Fenster und Verglasungen, den Sonnenschutz, die Dämmung und andere bauphysikalische Eigenschaften, die sich auf den sommerlichen Wärmeschutz auswirken.
3
Festlegung von Grenzwerten und Anforderungen: Basierend auf den Berechnungen und Analysen werden Grenzwerte und Anforderungen festgelegt, um sicherzustellen, dass das Gebäude ein angemessenes Maß an sommerlichem Wärmeschutz bietet. Diese Standards können je nach Standort und Nutzung des Gebäudes variieren.
4
Optimierung des sommerlichen Wärmeschutzes: Der Nachweis kann Empfehlungen zur Optimierung des sommerlichen Wärmeschutzes bieten, einschließlich Maßnahmen wie den Einsatz von Sonnenschutzsystemen, die Auswahl von geeigneten Baumaterialien oder die Anpassung der Gebäudeausrichtung, um Überhitzung zu verhindern.
Bei Neubauten oder Gebäudeerweiterungen von mehr als 50 m², besteht eine Nachweispflicht des sommerlichen Wärmeschutzes.

Thermische Simulation
Die Thermische Simulation ist ein Schlüsselbereich in der Bauplanung und -bewertung, der sich auf die detaillierte Analyse und Vorhersage des Temperaturverhaltens in Gebäuden konzentriert. Sie spielt eine entscheidende Rolle bei der Optimierung der Energieeffizienz, des thermischen Komforts und der Nachhaltigkeit von Bauwerken.
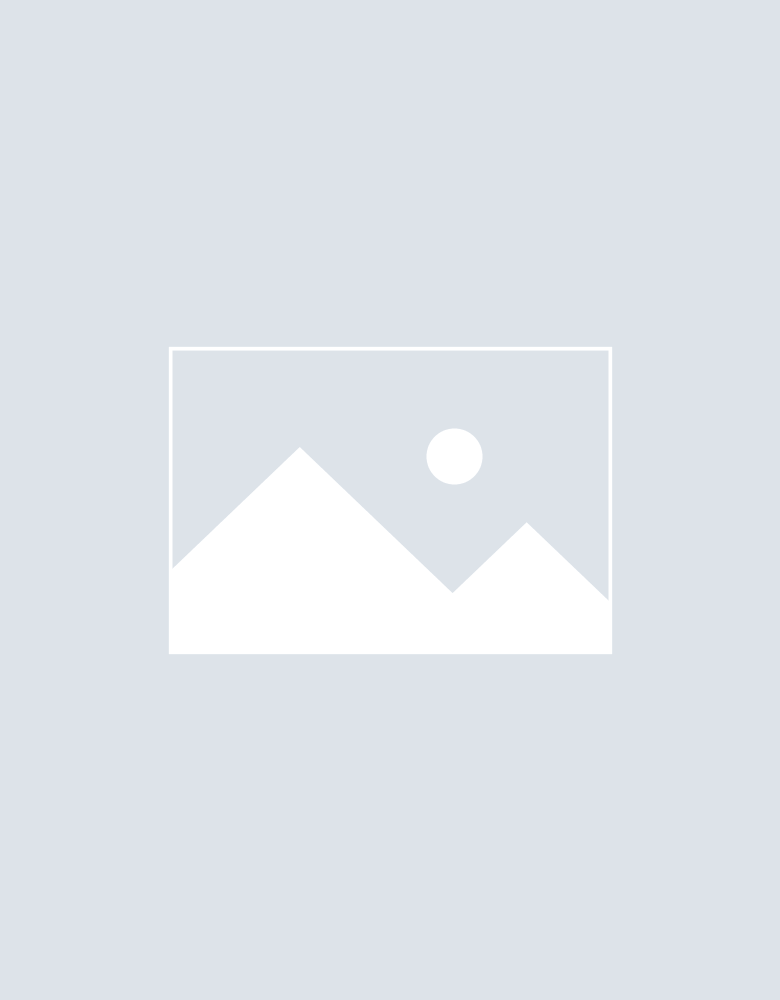
Technische Simulationen
Die Thermische Simulation ist ein unverzichtbares Werkzeug, um die Energieeffizienz, den thermischen Komfort und die Nachhaltigkeit von Gebäuden und Anlagen zu verbessern. Sie trägt dazu bei, energieeffiziente Lösungen zu entwickeln, Energiekosten zu senken und die Umweltauswirkungen zu minimieren.
Wärmebrückenberechnung
1
Identifikation von Wärmebrücken: Der erste Schritt bei der Wärmebrückenberechnung besteht darin, Wärmebrücken zu identifizieren. Dies sind Stellen in der Gebäudehülle, an denen Wärmeübertragung unerwünscht stattfindet, wie beispielsweise an Ecken, Verbindungsstellen von Bauteilen oder bei Durchdringungen.
2
Berechnung der Wärmeübertragung: Die Berechnung der Wärmeübertragung an den identifizierten Wärmebrücken erfolgt anhand von bauphysikalischen Daten, wie den Baustoffeigenschaften und den geometrischen Merkmalen der betreffenden Stellen. Diese Berechnungen ermöglichen die Quantifizierung der Wärmeverluste.
3
Thermische Verbesserungen: Nachdem Wärmebrücken identifiziert und berechnet wurden, können Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung ergriffen werden. Dies kann die Verwendung besserer Dämmmaterialien, die Anpassung der Gebäudegeometrie oder die Vermeidung von Kältebrücken sein.
4
Einhaltung von Standards und Normen: Die Wärmebrückenberechnung sollte in Übereinstimmung mit den geltenden Bauvorschriften und Normen durchgeführt werden. Dies gewährleistet die Einhaltung von Energieeffizienzanforderungen und sorgt für die Qualität der Berechnungen.
Die Berechnung der Wärmebrücken wird nur für Neubauten angeboten. Dieser ist nur mit detaillierten Bauplänen möglich.
Anlagensimulation
1
Berechnung der Anlagenleistung: Die Anlagensimulation umfasst die Berechnung der Leistung von HLK-Anlagen, um sicherzustellen, dass sie den erforderlichen thermischen Komfort und die Energieeffizienz bieten. Dies beinhaltet die Berücksichtigung von Faktoren wie Heizleistung, Kühlleistung, Luftqualität und Energieverbrauch.
2
Optimierung von HLK-Systemen: Durch die Simulation von HLK-Anlagen können verschiedene Konfigurationen und Einstellungen getestet werden, um die optimale Leistung und Energieeffizienz zu erzielen. Dies kann die Auswahl geeigneter Heiz- und Kühltechnologien, die Regelungssysteme und die Dimensionierung der Anlagen umfassen.
3
Integration erneuerbarer Energien: Die Anlagensimulation ermöglicht die Integration erneuerbarer Energiequellen, wie Solarenergie oder Wärmepumpen, in die HLK-Systeme. Dies trägt zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Umweltauswirkungen bei.
4
Berücksichtigung von Umweltauswirkungen: Die Simulation von HLK-Anlagen ermöglicht die Bewertung der Umweltauswirkungen, wie beispielsweise den CO2-Ausstoß, und trägt zur Entwicklung nachhaltigerer Lösungen bei.
Erneuerbare Energieerzeuger können von der BAFA bis zu 40% gefördert werden.
Kältesimulation
1
Berechnung der Kühllasten: Die Kältesimulation umfasst die Berechnung der Kühllasten von Gebäuden, Räumen und Zonen. Dies beinhaltet die Analyse der internen Wärmequellen, der Sonneneinstrahlung, der Außentemperaturen und anderer Faktoren, um den Bedarf an Kühlung zu bestimmen.
2
Dimensionierung von Kälteanlagen: Die Ergebnisse der Kältesimulation werden zur richtigen Dimensionierung von Kälteanlagen und -systemen verwendet. Dies stellt sicher, dass die Kühlanlagen ausreichend dimensioniert sind, um den ermittelten Kältebedarf zu decken, ohne unnötigen Energieverbrauch.
3
Thermischer Komfort in wärmeren Klimazonen: In Regionen mit warmem Klima ist die Kältesimulation entscheidend, um den thermischen Komfort in Gebäuden sicherzustellen. Sie ermöglicht die Berechnung und Planung von Kühlsystemen, um den Bewohnern angenehme Raumtemperaturen zu bieten.
4
Energieeffizienz und Umweltauswirkungen: Die Kältesimulation trägt zur Energieeffizienz bei, indem sie den Bedarf an Kühlung optimiert und den Energieverbrauch minimiert. Dies hat positive Auswirkungen auf die Umwelt, da weniger Energie benötigt wird, um Gebäude zu kühlen.
Die Berechnungen erfolgen nach VDI-Richtlinien 2078 und 6007.

Bauphysikalische Messungen
Bauphysikalische Messungen sind ein wesentlicher Bestandteil der Qualitätskontrolle und -bewertung von Gebäuden. Sie dienen der Erfassung und Analyse verschiedener physikalischer Eigenschaften und Parameter, die das Raumklima, die Energieeffizienz und den thermischen Komfort beeinflussen.
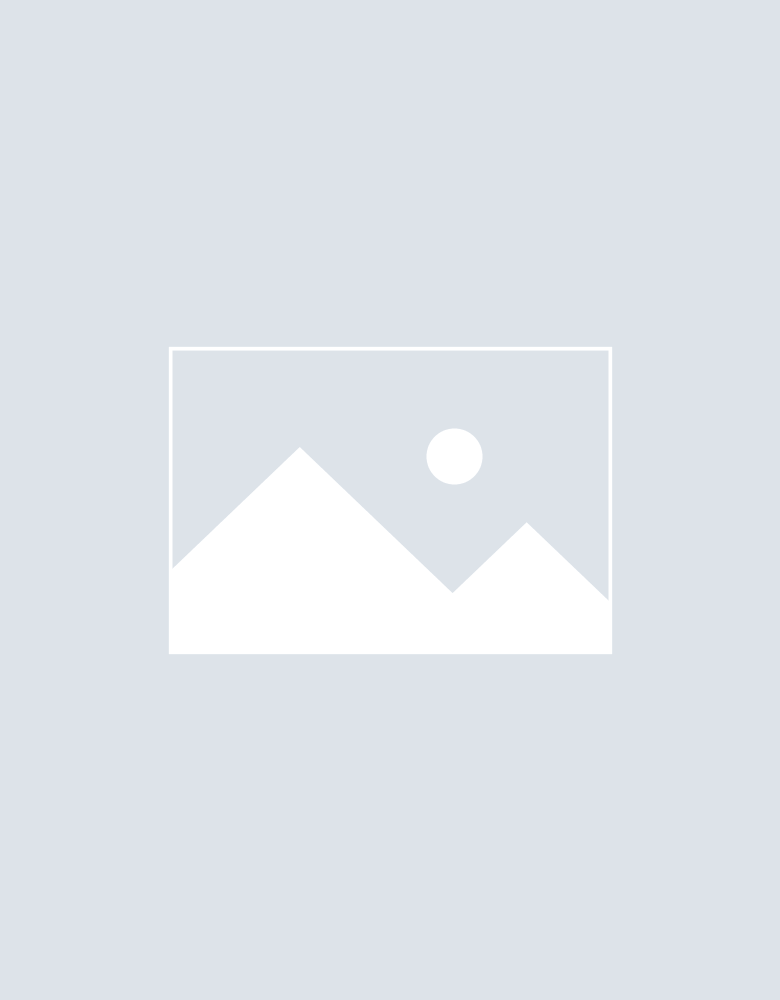
Messungen im Gebäudesektor
Bauphysikalische Messungen sind unverzichtbar, um Energieeffizienzstandards zu erfüllen, Energiekosten zu senken und den thermischen Komfort in Gebäuden zu gewährleisten. Sie tragen dazu bei, Gebäude besser zu verstehen und zu optimieren, um den Anforderungen an nachhaltiges Bauen gerecht zu werden.
Temperatur- und Feuchtemessung
1
Thermischer Komfort: Die Messung der Raumtemperatur ist entscheidend für den thermischen Komfort in Gebäuden. Sie hilft sicherzustellen, dass die Temperaturen in Innenräumen innerhalb eines angenehmen Bereichs liegen und den Bedürfnissen der Bewohner entsprechen.
2
Feuchtemessung: Die Messung der Luftfeuchtigkeit ist wichtig, um das Feuchteniveau in Innenräumen zu überwachen. Ein angemessener Feuchtigkeitsgehalt ist entscheidend, um Feuchtigkeitsprobleme, wie Schimmelbildung, zu vermeiden und die Gesundheit der Bewohner zu schützen.
3
Klimaoptimierung: Temperatur- und Feuchtemessungen werden verwendet, um die Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK-Anlagen) zu steuern und zu optimieren. Sie tragen zur Energieeffizienz bei, indem sie sicherstellen, dass die HLK-Systeme nur dann aktiviert werden, wenn dies erforderlich ist.
4
Messdatenanalyse: Die erfassten Messdaten können zur Analyse des Energieverbrauchs und zur Identifizierung von Verbesserungsmöglichkeiten verwendet werden. Dies kann zur Entwicklung von Strategien zur Energieeinsparung und zur Erhöhung der Gebäudeeffizienz beitragen.
Baubegleitung: Der Fördersatz beträgt 50 % der förderfähigen Ausgaben.
Blower-Door-Messung
1
Luftdichtheitsbewertung: Die Blower-Door-Messung ermöglicht die Bewertung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Sie misst den Luftaustausch durch Undichtigkeiten in der Gebäudehülle und quantifiziert, wie gut das Gebäude vor unkontrolliertem Luftaustausch schützt.
2
Identifikation von Leckagen: Die Messung hilft dabei, undichte Stellen oder Leckagen in der Gebäudehülle zu identifizieren. Diese Leckagen können an Stellen auftreten, an denen Bauteile unzureichend miteinander verbunden sind, wie Fenster, Türen, Anschlüsse oder Durchdringungen.
3
Energieeffizienzsteigerung: Die Identifizierung und Beseitigung von Leckagen trägt zur Steigerung der Energieeffizienz bei. Durch die Verbesserung der Luftdichtheit können Wärmeverluste reduziert, Heizkosten gesenkt und der thermische Komfort erhöht werden.
4
Qualitätskontrolle: Blower-Door-Messungen dienen als Qualitätskontrolle während des Bauprozesses und bei Sanierungsarbeiten. Sie stellen sicher, dass die Gebäudehülle den geltenden Standards und Anforderungen entspricht.
Für die Planung und Beantragung eines KFW-Effizienzhauses sollte die Blower-Door-Messung in Betracht gezogen werden.
